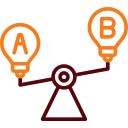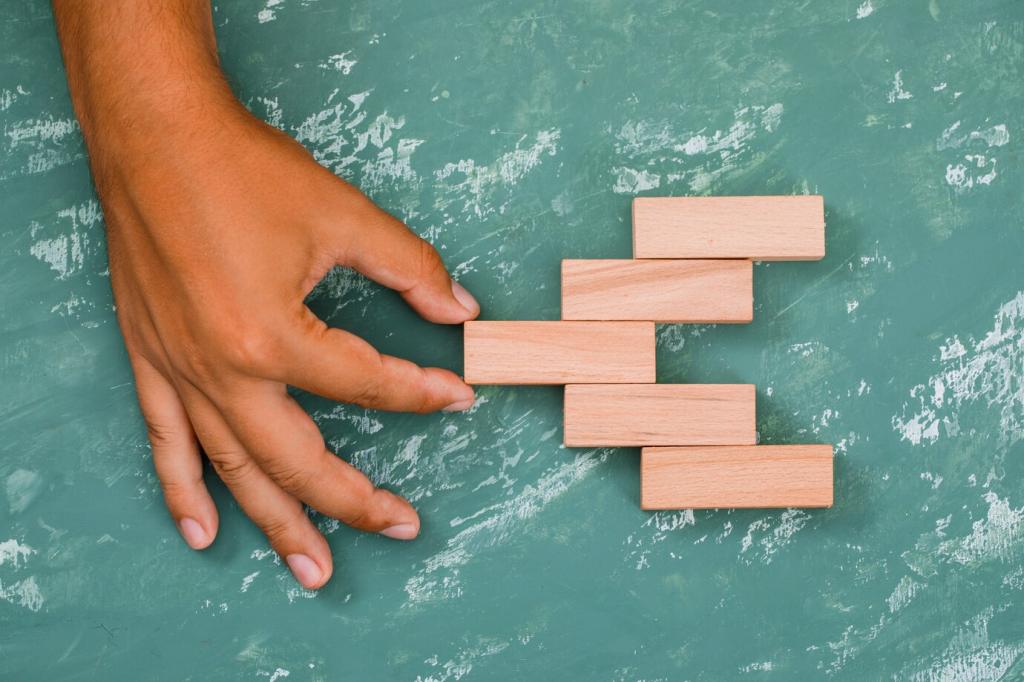Materialporträts: Beton, Holz, Schaumglas und mehr
Stahlbeton punktet mit hoher Tragfähigkeit und Wärmespeichervermögen, leitet jedoch Wärme vergleichsweise gut. Kombiniert mit durchgehender Perimeterdämmung oder Schaumglas unter der Platte entstehen robuste, energieeffiziente Systeme. Wichtig sind thermische Trennungen bei Vorsprüngen und Treppen, um punktuelle Wärmebrücken zu vermeiden.
Materialporträts: Beton, Holz, Schaumglas und mehr
Holz bietet geringe Wärmeleitfähigkeit und kann Wärmebrücken reduzieren, erfordert aber konsequenten Feuchteschutz und statische Planung. Punktfundamente minimieren Erdberührung und übertragen Lasten gezielt. In Kombination mit gut gedämmten Sockelelementen entsteht ein leichter, trockener und energieeffizienter Aufbau, gerade für kleinere Baukörper.